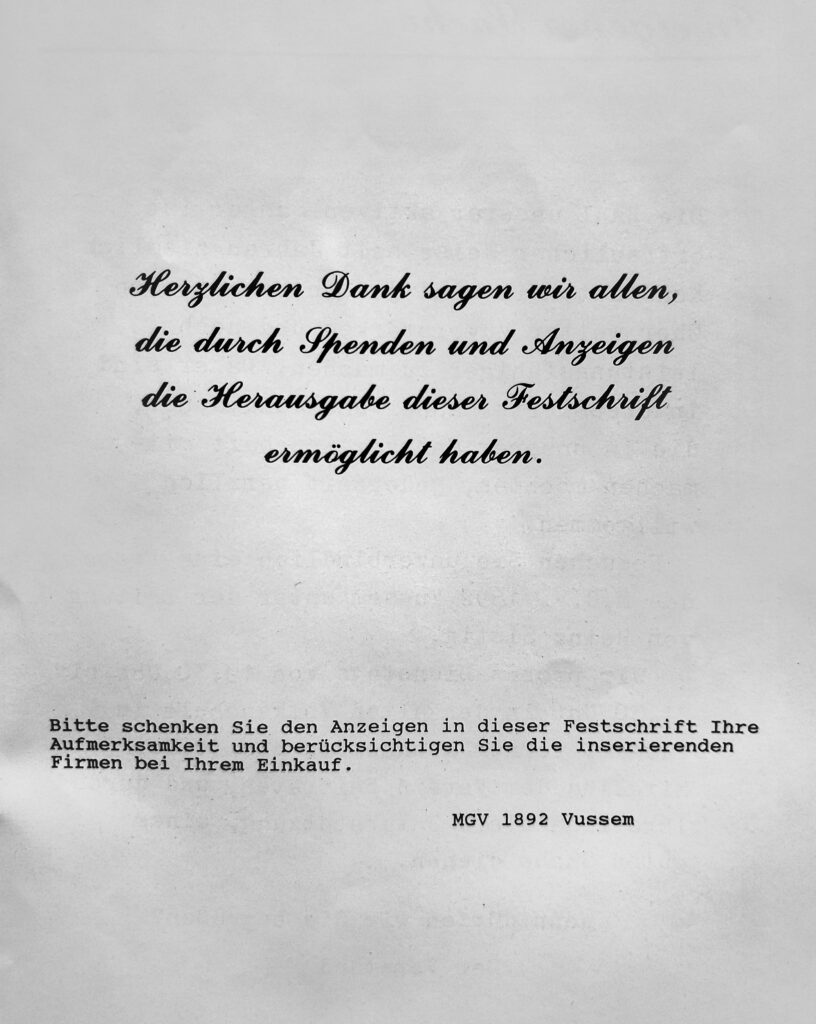Die Anfänge des Männerchorgesanges …
… lassen sich auf die Initiativen von Carl Friedrich Zelter und Hans Georg Nägeli zurückführen.
Der Männerchor-Gesang, wie er in vielfältigen Formen bis heute gepflegt wird, ist ein Kind des frühen 19. Jahrhunderts. Er entsprang zwei gänzlich verschiedenen Ideen und Initiativen. Am 24.01.1809 gründete Carl Friedrich Zelter (1758 – 1832), ein Maurermeister und späterer Professor an der königlichen Akademie der Künste in Berlin, die erste „Liedertafel“. Sie ging hervor aus der „Singakademie“ von Zelters musikalischem Lehrer C. F. Fasch, deren Mitglied er seit 1791 war. Inspiriert von König Artus’ Tafelrunde, vereinigte Zelter aus dem Kreise der Mitglieder der Singakademie 25 Männer der Wissenschaft und der Kunst zu einer exklusiven Gesellschaft. Dieser Berliner Liedertafel konnten nur Dichter, Berufssänger und Komponisten angehören. Die Zahl ihrer Mitglieder blieb lange Zeit auf 25 beschränkt. „Die Gesellschaft versammelte sich monatlich einmal bei einem Abendmahle von zwei Gerichten und vergnügte sich an gefälligen deutschen Gesängen“ (die von ihren Mitgliedern geschaffen und von ihnen als Soli oder mehrstimmig vorgetragen wurden). Diesen geselligen „Tafelrunden“ entstammt eine Fülle mehrstimmiger Literatur für Männerchöre.
Zelter’s Liedertafel gab Anlaß zur Gründung ähnlicher, mehr oder minder geschlossener Sängervereinigungen, z. B. in Frankfurt a. d. Oder und Leipzig (1815), Magdeburg (1819), Dessau (1821), Hamburg, Danzig und Königsberg (1823/24). Diese Liedertafeln bereicherten die Literatur für Männergesang. Sie blieben jedoch mehr oder weniger Vereinigungen, die den Chorgesang zur eigenen Freude pflegten und öffentliche Auftritte mieden. Durch die Beschränkung der Mitgliederzahl erstrebten und erreichten sie den Status von Honoratioren-Zirkeln.
Die zweite Initiative auf dem Gebiet des Männerchor-Gesanges ging von dem Schweizer Musiker und Pfarrerssohn Hans-Georg Nägeli (1773 – 1836) aus, der 1810 in Zürich den ersten „Männerchor“ gründete. Im Gegensatz zur Liedertafel Zelters wandte sich Nägelis Männerchor der Pflege des Chorgesangs „auf volksmäßiger Grundlage“ zu. Sein Repertoire bildete vornehmlich das überlieferte, bearbeitete Volkslied. Sein Männerchor war für jedermann offen.
Nägeli’s Bestrebungen fanden starken Widerhall in allen deutschsprachigen Kantonen der Schweiz, wo sich allerorten Männerchöre bildeten. Nägeli gab 1817 eine „Gesangsbildungslehre für Männerchor“ heraus und 1820 eine „Chorgesangschule“. Die Sängervereine am Züricher See schlossen sich zu einem Bund zusammen, der 1826 das erste Zürichsee-Sängerfest veranstaltete.
Von der Schweiz aus verbreitete sich das Interesse für den Männerchor-Gesang nach Süddeutschland. Es entstanden dort zahlreiche „Liederkränze“, so in Stuttgart, Ulm, Göppingen, Reutlingen, Eßlingen, Heilbronn und in anderen Städten. Pfingsten 1827 fanden sich die schwäbischen Vereine zu einem ersten deutschen Liederfest in Plochingen zusammen.
Hans-Georg Nägeli hielt in den Jahren 1819 bis 1825 in Karlsruhe und in mehreren rheinischen Städten Vorträge über den Volks und Männergesang. Durch diese Vorträge angeregt, entstanden im Badischen die ersten Liederkränze im Jahre 1824, ihnen. folgte die Gründung von Sängervereinigungen in rheinischen Städten. Beim ersten deutschen Liederfest in Plochingen im Jahre 1827 sang ein großer Gemeinschaftschor unter anderen das Lied „Freiheit, die ich meine“. Ein Konrektor Pfaff führte als Festredner u.a. aus, der Chorgesang ermögliche dem einzelnen Sänger, einmal herauszutreten aus den engen Schranken des Berufes, frei von des Lebens Müh’ und Bürde. Des Liedes Klang stärke das Herz und hebe frisch den schon gesunkenen Mut. Lebenslust zöge auf des Gesanges brausenden Wogen in die Brust des Sterblichen, und vor des Gesanges Macht würden der Stände lächerliche Schranken niedersinken.
In den Festgesängen und Festreden war eine liberale, republikanische Strömung unüberhörbar.
Die in der Nachfolge von Zelters Berliner Liedertafel entstandenen gleichartigen Vereinigungen traten um 1830 untereinander in eine engere Beziehung. Es bildeten sich im Raum Magdeburg und im norddeutschen Gebiet lose Vereinigungen von Liedertafeln, vornehmlich mit dem Ziel, alljährlich ein gemeinsames Sängerfest zu veranstalten. Seit 1839 fanden Sängerfeste der Liedertafeln in jährlicher Folge statt. Die sich über mehrere Tage erstreckenden Festveranstaltungen galten nicht einer breiten Öffentlichkeit, sondern vornehmlich dem Kreis der Teilnehmer. Hauptbestandteile dieser Feste blieben noch lange die gemeinschaftlichen „Tafeln“, die festlichen Essen.
Rheinische Vereinsformen
Die von Zelter und von Nägeli ausgehenden Bestrebungen, den mehrstimmigen Männerchor-Gesang zu entfalten, ihm Formen und Gestalt zu geben, wurden in den ersten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts vielerorts aufgenommen. Sie wandelten sich unter den Einwirkungen der Zeitläufe. Die unterschiedlichsten Ausgangsformen de Männerchor-Gesanges vermischten und verwischten sich, je länger, je mehr. Die „Liederkränze'“ Nägeli’scher Art übernahmen Formen und Literatur der Zelter’schen „Liedertafeln“, und umgekehrt traten die „Liedertafeln“ aus ihrer Selbstgenügsamkeit heraus, wirkten verhalten in die Öffentlichkeit hinein und maßen ihr Können mit den Chören anderer Provenienz.
1824 wurde die Aachener Liedertafel Zelter’scher Art gegründet. 1842 bildete sich der „Kölner Männergesangverein“. Er war nicht der erste seiner Art in Köln. Seine Satzung bezeichnete als Zweck des Vereins den Männergesang in seiner ganzen Größe und Macht zur Ehre zu bringen die Verbreitung des deutschen Liedes durch öffentliche Aufführungen zu patriotischen, vaterstädtischen und wohltätigen Zwecken zu fördern nach dem Wahlspruch: „Durch das Schöne stets das Gute.“
So bildete sich in Abkehr von bestimmten Formen der Zelter’schen Liedertafel und unter Aufgabe des liberalen und republikanischen Gedankengutes der Nägeli‘schen Liederkränze eine spezifisch rheinisch Form der Sängervereinigung. Sie setzte sich vornehmlich zum Ziel, der Ausgestaltung öffentlicher Veranstaltungen zu dienen.
In unserer näheren Umgebung bildeten sich im heutigen Kreis Euskirche: 1844 der Zülpicher Männerchor und vier Jahre später, 1848, der MGV Flamersheim. 1853 entstand der MGV Gemünd, 1858 gründete sich der MGV Kommern, 1863 der MGV Mechernich.
Der Aquädukt bei Vussem und die römische Wasserleitung
Zum Zwecke der Überquerung eines Seitentales des Feybaches (Altebach), errichteten die römischen Ingenieure eine Brücke für die Eifelwasserleitung nach Köln. Im Volksmund auch Teufelsader genannt.
Der Anlaß zu einer intensiven archäologischen Untersuchung ergab sich, als bei Anlage des Sportplatzes Vussem der kleine Bachlauf begradigt und bei Wegearbeiten die Reste bzw. Pfeilerfundamente angerissen worden sind. An dieser Stelle haben die Römer eine Talumgehung mittels einer Aquäduktbrücke abgekürzt, für die ein verhältnismäßig großer Aufwand betrieben werden mußte. Die Brückenreste wurden von W. HABEREY im Jahre 1959 untersucht, wonach das Bauwerk 1960/61 teilweise rekonstruiert werden konnte.
Vor der Ausgrabung waren von der römischen Brücke in diesem Bereich nur noch die Stümpfe von drei ehemaligen Pfeilern im Gelände auszumachen. Mitte des vorigen Jahrhunderts war vom alten Bestand durchaus noch mehr zu sehen, denn EICK berichtet 1867, daß die Aquäduktbrücke selbst „heute nur noch in den Substruktionen an beiden Abhängen und dem in der Mitte des Thales befindlichen Pfeilerfundamente erkenntlich“ sei. „Jedoch erinnern sich ältere Leute der Umgebung, daß hoch anstehende Trümmer der Bögen noch vorhanden waren, und man hier Schutz vor Regen fand.“
In den achtziger Jahren des vorigen Jhd. hatte ein Archäologe namens CLEVER schon einmal Ausgrabungen vorgenommen, und die Grundmauern von sechs Pfeilern der Brücke nachgewiesen.
Der Aquädukt bestand ehemals aus einer auf zehn bis zwölf freitragenden Pfeilerngeführten Kanalrinne, die das Wasser in etwa
10 m Höhe auf einer Strecke von 80 m oberirdisch von einer Talseite zur anderen führte. Das Mauerwerk der Pfeiler bestand aus Grauwackesteinenmit reichlich verwendetem Mörtel. Außen ist es sauber mit kleinen Grauwacke Quadern verblendet.
Der archäologische Befund zeigte, daß der Übergang der Leitung von der obertägigen Brücke in den unterirdischen Streckenverlauf sehr solide ausgeführt war. Der letzte Brückenpfeiler stand auf einem 2,8m langen, gemauerten Sockel, der 2,0 m tief gegründet war. Auf diesem hatte man eine 0,4 m hohe Packlage aus schräg gestellten Grauwacke Steinen errichtet, auf der die Kämpferplatte für den letzten Bogen der Brücke und das Fundament für die Einführung des Kanales in den Berg auflagen. Auch die mittleren Pfeiler der Brücke saßen auf soliden Fundamenten auf, von denen eines untersucht werden konnte. Dieses war 2,4 m lang. 1,4 m oberhalb seiner Unterkante konnten Reste einer „mörtellosen Blockverblendung aus Sandstein“ erkannt werden.
Die Bauwerksreste der Pfeiler und der beiderseits anschließenden Kanalrinne, die nachweisbaren Abstandsmaße zwischen den Pfeilern von 2,5 m lichter Weite sowie die Höhenlage der Kanalsohle oberhalb und unterhalb der Brücke, erlaubten dieses Brückenbauwerk recht genau zu rekonstruieren. Auch wenn bei der Untersuchung von zwei Pfeilern keine Fundamentreste gefunden werden konnten, ist nicht anzunehmen, daß zwei Bogen Öffnungen in dieser Brücke mit der doppelten Spannweite versehen waren. Wir dürfen vielmehr annehmen, daß in Vussem eine auf zwölf Pfeilern ruhende Aquäduktbrücke gestanden hat, die wir der mittleren Größe dieser Bauwerkskategorie zurechnen dürfen.
Im Gelände ist der Kanalverlauf besonders im Anschluß an die Brücke hervorragend zu verfolgen, da hier sogar heute noch die römische Baustraße sichtbar geblieben ist. Hier kann man sich den Arbeitsablauf auf einer solchen römischen Baustelle lebhaft vorstellen; denn nach der Abholzung und der Trassenabsteckung durch den GROMATIKER (römischer Vermessungsfachmann) wurde erst einmal eine Arbeitsterasse in den Hang gearbeitet. Darin wurde dann in der Hangseite der Graben für den Kanal eingetieft, und auf ihr wurde das erforderliche Baumaterial transportiert und bearbeitet. Nach dem Ausbau der Strecke wurde der Kanal zwar zugeschüttet, um ihn vor Frost und Zerstörung zu schützen, die Terasse hat man aber erhalten und zu einem den Kanal begleitenden Arbeitsweg umfunktioniert.
Jahrhunderte später, vornehmlich im 11. bis 13. Jhd. hat man diese Straße beim Ausbruch des Kanalmauerwerkes zur baulichen Wiederverwendung natürlich gern ein zweites Mal benutzt. Im bergigen Teil der Strecke, wie auch hier im östlichen Anschluß an die Vussemer Aquäduktbrücke, ist der Kanalverlauf oftmals nur noch an diesem erhalten gebliebenen römischen Arbeitsweg im Gelände erkennbar. Knapp 80 m im Anschluß an die Brücke ist der Rest eines der vielen Einstiegschächte zu besichtigen, die den Römern ehemals wohl zu Revisions- und Reinigungszwecken gedient haben.
Das 25 m lange Stück vor der Talüberquerung ist bei der Ausgrabung zum Teil freigelegt, zum Teil abgetastet worden. Das Gewölbe war dort überall schon vorher eingeschlagen. Die Rinne war aber stellenweise bis zum Gewölbebeginn erhalten. Auffallend war auf dieser Strecke, daß sich hier Kalksinter bis in das Gewölbe hinauf abgesetzt hat, während er sonst nur 0,4 – 0,6 m hoch an den Wangen heraufreicht. Die Ursache dafür ist in einer Verstopfung weiter leitungsabwärts zu suchen.
Bei der Errichtung des Ehrenmals wurde auf der Rückseite das Kanalmauerwerk teilweise beseitigt. Auf dem Friedhof wurde die Leitung von einigen Grabschächten angeschnitten. Von einem Grab, so wird erzählt, mußte der Sarg in die gemauerte Rinne gezwängt werden.
Der beim Bau der römischen Eifelwasserleitung verursachte Geländeeingriff hat natürlich seine sichtbaren Spuren hinterlassen. Besonders unter Wald hat sich die römische Arbeitsterasse meist gut erhalten können, während sie in der freien Feldflur durch die landwirtschaftliche Nutzung in nachrömischer Zeit auf weite Strecken eingeebnet worden ist.

Kapelle Vussem

Rektoratskirche St. Margareta
Neuhütte und Vussem
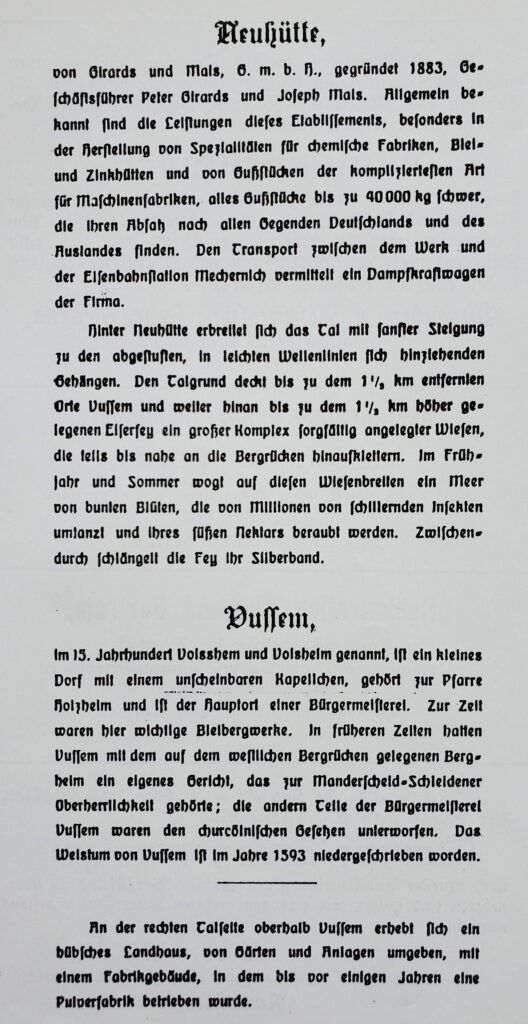
Gedenken an die Toten!
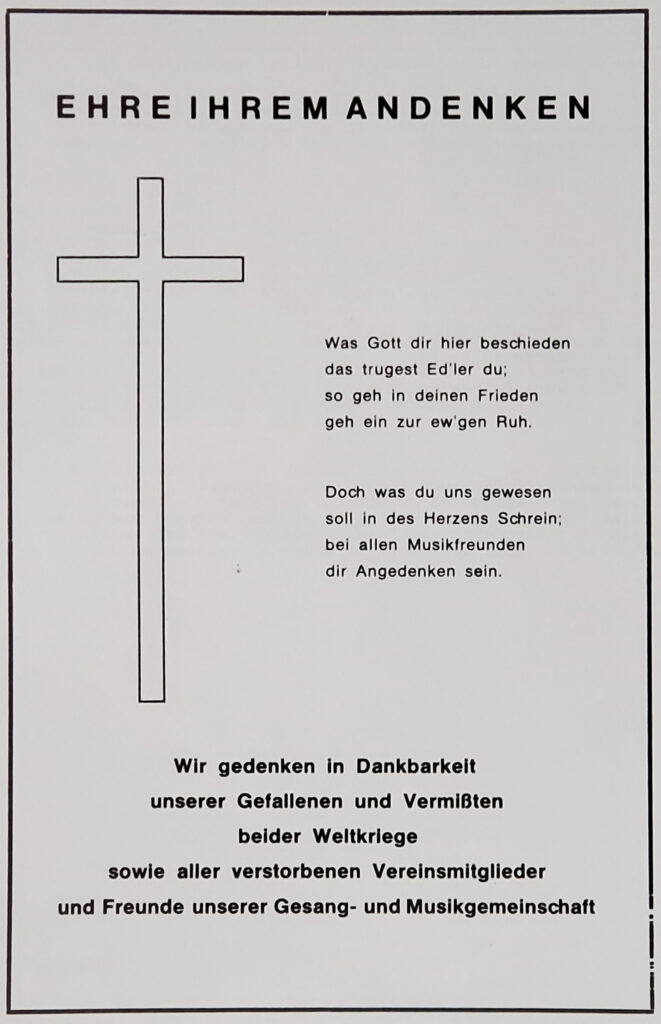
Danksagung